9:00 -18:00
Montag bis Freitag


Elektromobilität wird in Wohnungseigentümergemeinschaften (WEGs) immer häufiger zum Thema. Doch die Frage, wer für Ladeinfrastruktur und Wallboxen zahlt, sorgt nicht selten für hitzige Diskussionen. Viele Eigentümer wünschen sich eine Lösung, die sowohl praktikabel als auch fair ist.
In diesem Artikel erzählen wir von einer echten Kundensituation und klären dabei die rechtlichen Grundlagen, typische Herausforderungen und geben Ihnen konkrete Lösungsansätze an die Hand.
In Deutschland hat jeder Eigentümer das gesetzliche Recht, eine Ladestation für sein Elektroauto an seinem Stellplatz zu installieren. Dieses Recht wurde durch die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) gestärkt. Es bedeutet, dass eine individuelle Wallbox von der WEG grundsätzlich nicht verhindert werden kann.
Komplexer wird die Situation, wenn es um die sogenannte Grundinstallation geht. Diese umfasst die baulichen Vorbereitungen in einer Tiefgarage oder auf anderen Gemeinschaftsstellplätzen, die das Bindeglied zwischen Ladestationen und Stromnetz bildet. Eine solche Grundinstallation wird als bauliche Veränderung eingestuft und muss von der WEG beschlossen werden. Dabei gelten klare rechtliche Regelungen:
Die Kosten der Grundinstallation müssen nicht zwangsläufig von allen Eigentümern getragen werden. Interessierte Parteien können die Kosten alleine übernehmen, wobei die Grundinstallation in diesem Fall ausschließlich diesen Parteien gehört. Meistens ist es jedoch einfacher und effektiver, die Kosten zwischen allen Bewohnern beziehungsweise Stellplatzeigentümern aufzuteilen. Dies hängt davon ab, ob die Tiefgarage zum Gemeinschaftseigentum oder zum Sondereigentum zählt. Diese Regelung sorgt für eine gerechtere Verteilung der finanziellen Last und vermeidet potenzielle Konflikte.
Eine Ausnahme bildet die Situation, in der eine bauliche Veränderung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln beschlossen wird. In diesem Fall müssen die Kosten auf alle Eigentümer umgelegt werden. Genau hier liegt oft das Konfliktpotenzial.

Ein anschauliches Beispiel liefert die Familie Müller, die uns kürzlich kontaktierte. Sie leben in einer großen WEG mit 92 Parteien, in der jeder Wohnung ein Stellplatz in der Tiefgarage zugeordnet ist. Schon seit Jahren gibt es in der WEG Eigentümer, die sich eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos wünschen. Doch eine Einigung war bislang schwierig.
Die Müllers selbst haben kein Interesse an Elektromobilität und möchten sich daher auch nicht an den Kosten für eine Grundinstallation beteiligen. Trotzdem beobachten sie mit Sorge die Entwicklungen in der Gemeinschaft. Auf einer vergangenen Eigentümerversammlung wurde beschlossen, Angebote für die Installation einer Grundinfrastruktur einzuholen. Doch als die Angebote vorlagen, wurde schnell klar, dass diese schwer vergleichbar waren – sowohl in Bezug auf die Kosten als auch auf die technische Umsetzung.

Zusätzlich stellte sich heraus, dass die Stromkapazität der Tiefgarage begrenzt ist. Für alle 92 Stellplätze gleichzeitig wäre weder eine 11-kW- noch eine 22-kW-Lösung realistisch. Dies hätte enorme Kosten zur Folge, was die Skepsis vieler Eigentümer noch verstärkte. Vor diesem Hintergrund fragten die Müllers nach Alternativen, die sowohl fair als auch praktikabel sind.
Aus diesen Gründen hat die WEG uns beauftragt, die Machbarkeit zu prüfen und verschiedene Planungsvorschläge im Rahmen eines Elektromobilitätskonzeptes vorzuschlagen. Unser Ziel war es, sowohl den aktuellen Bedarf als auch die zukünftige Erweiterbarkeit der Infrastruktur zu berücksichtigen, um langfristige Konflikte und hohe Folgekosten zu vermeiden.
Die Situation der Familie Müller zeigt exemplarisch, wie unterschiedlich die Interessen innerhalb einer WEG sein können. Eigentümer, die aktuell keine Wallbox benötigen, sehen oft keinen Grund, in eine Grundinstallation zu investieren. Um diese Interessenskonflikte zu entschärfen, bietet sich eine Interessensgemeinschaft Elektromobilität an. Hier können sich Eigentümer zusammenschließen, die Interesse an einer Ladeinfrastruktur haben, und gemeinsam die Kosten tragen. Neue Mitglieder, die später eine Wallbox installieren möchten, würden sich ebenfalls finanziell beteiligen.
Ein weiteres Problem stellt die oft unzureichende Stromkapazität in bestehenden Tiefgaragen dar. Bei einer Planung, die ausschließlich auf den aktuellen Bedarf ausgerichtet ist, können spätere Nachrüstungen sehr teuer werden. Deshalb empfehlen wir, bei der Planung der Grundinstallation langfristig zu denken. Werden beispielsweise dickere Leitungsrohre und ein flexibles Lastmanagementsystem eingeplant, kann die Infrastruktur später problemlos erweitert werden. Das reduziert langfristig die Kosten und vermeidet erneute bauliche Veränderungen.
Ein weiterer Stolperstein sind schlecht vergleichbare Angebote. Ohne eine detaillierte Planung bieten Fachfirmen oft sehr unterschiedliche Lösungen an, die sich schwer vergleichen lassen. Hier hilft die Beauftragung eines unabhängigen Planungsbüros. Dieses erstellt auf die Bedürfnisse der WEG zugeschnittene Ausschreibungsunterlagen. So können Angebote eingeholt werden, die vergleichbar sind und eine fundierte Entscheidungsgrundlage bieten.
Damit ein Elektromobilitätsprojekt nicht an Uneinigkeit scheitert, ist es ratsam, der Eigentümerversammlung zwei verschiedene Optionen zur Abstimmung zu stellen. Dies erhöht die Akzeptanz und ermöglicht einen Kompromiss, der den unterschiedlichen Interessen gerecht wird.
Die erste Option ist eine minimalistische Grundinstallation. Diese deckt nur den aktuellen Bedarf der Interessenten ab und ist daher kostengünstiger. Der Nachteil dieser Option liegt in den hohen Nachrüstungskosten, die entstehen können, wenn später mehr Eigentümer eine Wallbox wünschen. Diese Option eignet sich vor allem für WEGs, die kurzfristig Kosten sparen wollen oder bei denen eine Einigung über eine zukunftssichere Lösung schwierig ist. Sie bietet jedoch den Vorteil, dass interessierten Parteien eine erste, rechtlich saubere Grundlage für Wallboxen geschaffen wird. Gleichzeitig sensibilisiert diese Option die Bewohner dafür, welche Nachteile eine minimalistische Grundinstallation langfristig haben kann, was die Bereitschaft für eine zukunftssichere Option erhöhen kann.
Ein weiterer Punkt ist die technische Vorgabe vieler Netzbetreiber: Einzelne Wallboxen, die nicht durch eine gemeinsame Ladeinfrastruktur mit Lastmanagement verbunden sind, werden meist nicht genehmigt. Stattdessen fordern Netzbetreiber eine zentrale Ladeinfrastruktur, an die alle Wallboxen angeschlossen werden können. Dadurch ist selbst bei einer minimalen Installation ein grundlegendes Konzept unverzichtbar.

Die zweite Option ist eine zukunftssichere Grundinstallation, die alle Stellplätze der WEG einbezieht. Diese Lösung ist zwar mit höheren Anfangskosten verbunden, bietet jedoch langfristige Vorteile. Spätere Nachrüstungen sind einfacher und kostengünstiger, da die Infrastruktur bereits entsprechend vorbereitet ist. Sie schafft die Grundlage für eine effiziente und rechtssichere Nutzung der Ladeinfrastruktur, auch bei wachsendem Bedarf.
Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Wichtig ist, dass die Eigentümer umfassend informiert werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Transparenz bei den Kosten und eine klare Darstellung der langfristigen Auswirkungen sind entscheidend, um das Vertrauen der Eigentümer zu gewinnen.
Die Frage nach der Finanzierung der Ladeinfrastruktur ist eine der zentralen Herausforderungen in jeder WEG. Zwei Ansätze haben sich in der Praxis bewährt: die Bildung einer Interessensgemeinschaft Elektromobilität oder die Aufteilung der Kosten auf alle Bewohner.
Interessensgemeinschaft Elektromobilität
Hierbei schließen sich nur jene Eigentümer zusammen, die eine Wallbox oder Ladeinfrastruktur benötigen. Diese Gruppe trägt die gesamten Kosten für die Installation und den Betrieb der Grundinfrastruktur. Der Vorteil dieser Lösung liegt in der finanziellen Entlastung der übrigen Eigentümer, die kein Interesse an Elektromobilität haben. Neu hinzukommende Interessenten, die später eine Wallbox installieren möchten, müssen sich an den bereits getätigten Investitionen beteiligen, wodurch die Transparenz und Fairness gewahrt bleibt. Die Interessengemeinschaft ermöglicht zudem den Austritt von Bewohnern, die beispielsweise kein Interesse an Elektromobilität mehr haben oder umziehen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass die initialen Kosten pro Partei höher ausfallen, da sie auf weniger Personen verteilt werden.

Kostenaufteilung unter allen Bewohnern
Diese Methode sieht vor, die Kosten für die Grundinstallation gleichmäßig auf alle Eigentümer oder Stellplatzeigentümer zu verteilen. Insbesondere bei einer Tiefgarage, die zum Gemeinschaftseigentum gehört, ist diese Lösung oft praktikabel. Der Vorteil liegt in den geringeren Kosten pro Partei, da die Investitionen auf eine größere Gruppe verteilt werden. Zudem profitiert die gesamte WEG von einer zukunftssicheren Infrastruktur, die den Wert der Immobilie steigern kann. Allerdings kann diese Methode auf Widerstand stoßen, wenn einige Eigentümer kein Interesse an Elektromobilität haben oder sich nicht an den Kosten beteiligen wollen.
Welche Lösung die richtige ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten der WEG ab. Wichtig ist in jedem Fall, dass die verschiedenen Finanzierungslösung bestenfalls bereit zu Beginn der Eigentümerversammlung transparent erklärt werden und dass die gewählte Methode anschließend rechtlich sauber umgesetzt wird.
Elektromobilität in einer WEG ist ein Thema, das immer wieder zu Diskussionen führt. Mit einer durchdachten Planung und einer klaren Kommunikation können jedoch Konflikte vermieden werden. Indem Sie die rechtlichen Grundlagen darlegen, praxisnahe Lösungen anbieten und die Eigentümer umfassend informieren, schaffen Sie die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung. Egal ob minimalistisch oder zukunftssicher: Eine gut geplante Ladeinfrastruktur ist ein Gewinn für die gesamte WEG.

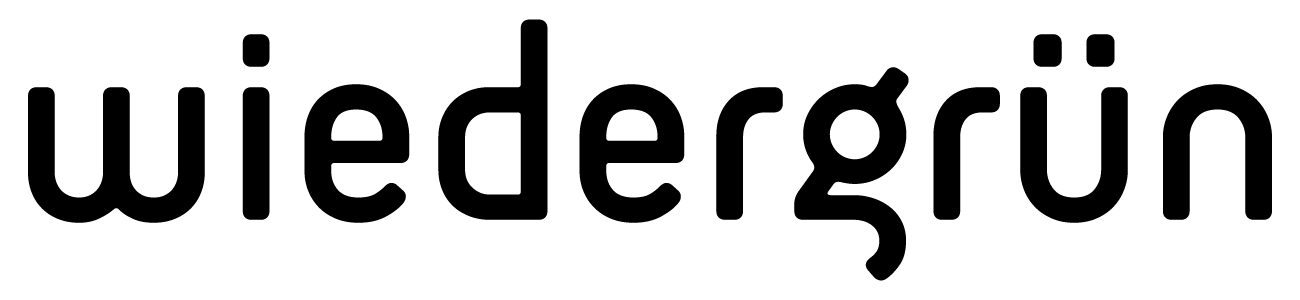
Wiedergrün ist ein Beratungs- und Ingenieurbüro, das sich auf Elektromobilität und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat. Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen für drei Hauptkundengruppen an: Immobilienunternehmen, Vermieter und Hausverwaltungen, KMU und mittelständische Unternehmen sowie Unternehmen der Ladeindustrie.
Weiterlesen